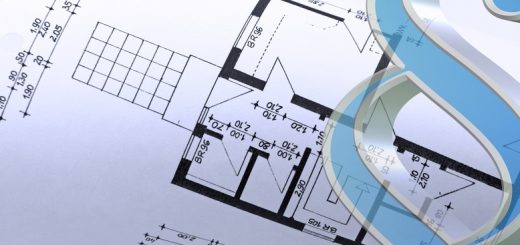Einwendungen gegen Gerichtsgutachten (erst) im Berufungsverfahren – nicht zu spät!
In Gerichtsverfahren mit baurechtlichem Bezug sind vor einer Entscheidung häufig technische Fragen zu klären, sei es zu (angeblichen) Mängeln, Maßen oder dem Leistungsstand. Richter sind zur Beantwortung dieser Fragen nicht fachkundig und beauftragen deshalb regelmäßig Sachverständige mit der Beantwortung dieser Fragen durch Erstellung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens. Nach Eingang des Gutachtens wird dieses den Parteien übersandt und eine Frist zur Stellungnahme gesetzt. Was aber passiert, wenn eine Partei erst lange nach Ablauf der Stellungnahmefrist, nämlich mit der Berufungsbegründung weitere Einwendungen gegen das Gerichtsgutachten vorbringt und hierzu erstmals ein selbst eingeholtes Gutachten, sog. Privatgutachten, vorlegt?
- Sachverhalt:
Mit dieser Frage hat sich vor dem Hintergrund von Amtshaftungsansprüchen gegen einen Prüfer, der bewusst gegen die einschlägigen Bezugsgrößen verstoßen hat, weshalb für das erworbene Ultraleichtflugzeug keine Zulassung vorlag, der III. Zivilsenat des BGH zu befassen.
Das Landgericht Braunschweig gab der Klage nach Verwertung eines in einem Parallelverfahren eingeholten gerichtlichen Gutachtens weitgehend statt, berücksichtigt hierbei aber Gebrauchsvorteile des klagenden Käufers nicht als anspruchsmindernd, weil es – so das Landgericht – an einer tauglichen Bezugsgröße fehle, aus der die zu erwartende Lebensdauer des Flugzeugs verlässlich abgeleitet werden könne. Das Oberlandesgericht Braunschweig hält sich an diese Feststellungen des Landgerichts gebunden und berücksichtigt insbesondere ein vom beklagten Prüfinstitut erstmals in der Berufungsinstanz vorgelegtes Privatgutachten nicht, mit dem dieses Einwendungen gegen das gerichtliche Sachverständigengutachten erhebt. Es ist der Auffassung, dass es sich dabei um neue Angriffs- und Verteidigungsmittel handelt und die Beklagten mit neuem Vortrag gemäß § 531 Abs. 2 ZPO präkludiert sei, da weder vorgetragen noch ersichtlich sei, dass sie ohne Verschulden außerstande gewesen sei, die Einwendungen erstinstanzlich zu erheben. Gelegenheit, ihre Einwendungen gegen das Sachverständigengutachten vorzubringen, hätte die Klage sowohl nach dem Beschluss gemäß § 411a ZPO über die Verwertung des im Parallelverfahren erstatteten Gutachtens des Sachverständigen als auch nach der mündlichen Verhandlung gehabt.
- Entscheidung:
Der BGH hat die Entscheidung mit Urteil vom 10.04.2025 – III ZR 431/23 aufgehoben und zur erneuten Entscheidung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.
Die Bemessung der Höhe eines Schadensersatzanspruchs – und damit auch des auf den Schaden anzurechnenden Vorteils – ist in erster Linie Sache des nach § 287 ZPO besonders freigestellten Tatrichters. Denn bei der Schadensschätzung steht ihm gemäß § 287 ZPO ein Ermessen zu, wobei in Kauf genommen wird, dass das Ergebnis unter Umständen mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Der Tatrichter muss dabei allerdings nach pflichtgemäßem Ermessen beurteilen, ob nach § 287 ZPO nicht wenigstens die Schätzung eines Mindestschadens möglich ist, und darf eine solche Schätzung erst dann gänzlich unterlassen, wenn sie mangels jeglicher konkreter Anhaltspunkte völlig in der Luft hinge und daher willkürlich wäre. Lässt das Berufungsurteil nicht erkennen, dass sich das Berufungsgericht der freieren Stellung nach § 287 ZPO bewusst gewesen war, handelt es sich um einen Rechtsfehler, der zur Aufhebung eines Urteils in der Revisionsinstanz führen kann. Dies war nach Auffassung des BGH beim Urteil des Oberlandesgerichts der Fall.
Das Berufungsgericht hat außerdem den Anspruch der Beklagten auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt, indem es angenommen hat, die Ausführungen seien wegen Verspätung nicht zu berücksichtigen. Ob die vom Kläger mit der Berufungsbegründung erhobenen Einwendungen gegen das Gerichtsgutachten neu sind, ist unerheblich. Nach § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO sind neue Angriffs- und Verteidigungsmittel nur dann zuzulassen, wenn es nicht auf Fahrlässigkeit der Partei beruht, dass sie in erster Instanz nicht vorgebracht worden sind. Eine Partei ist aber nicht verpflichtet, bereits in erster Instanz ihre Einwendungen gegen das Gerichtsgutachten auf die Beifügung eines Privatgutachtens oder auf sachverständigen Rat zu stützen. Sie ist vielmehr berechtigt, ihre Einwendungen zunächst ohne solche Hilfe vorzutragen. Auch in Fällen, in denen ein Erfolg versprechender Sachvortrag fachspezifische Fragen betrifft und besondere Sachkunde erfordert, dürfen bei einer Partei, die nur geringe Sachkunde hat, weder an ihren klagebegründenden Sachvortrag noch an ihre Einwendungen gegen ein Gerichtsgutachten, hohe Anforderungen gestellt werden. Insbesondere braucht sie über ihre hinreichend substantiierte Kritik an dem Gutachten hinaus keinen Privatgutachter einzuschalten
- Bewertung:
Die Entscheidung des BGH entspricht der jahrzehntelangen ständigen Rechtsprechung. Die Entscheidung des Oberlandesgericht ist daher überraschend, insbesondere weil keine Auseinandersetzung mit der abweichenden BGH Rechtsprechung erfolgte.
Die Entscheidung ist auch inhaltlich richtig. Es kann von Parteien nicht verlangt werden direkt – kostspielige – Privatgutachten einzuholen. Solange die Partei in der ersten Instanz überhaupt fristgerecht Einwendungen gegen das gerichtliche Gutachten vorbringt, genügt sie ihren prozessualen Pflichten. Gefährlich wird es für eine Partei nur dann, wenn überhaupt kein substantiierter Vortrag zum gerichtlichen Gutachten erfolgt.